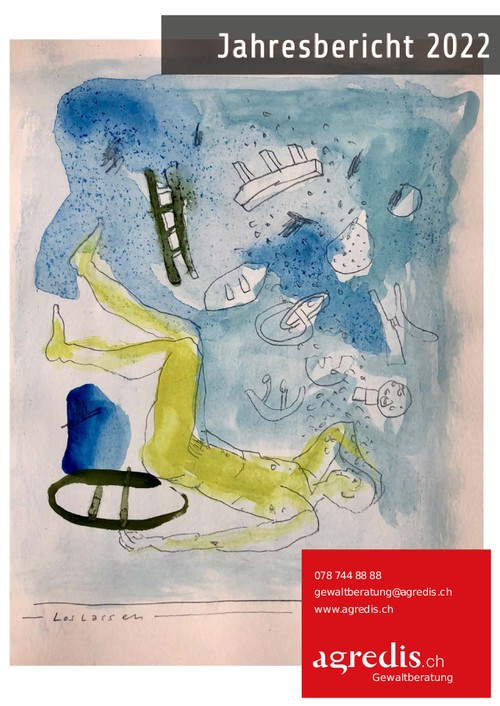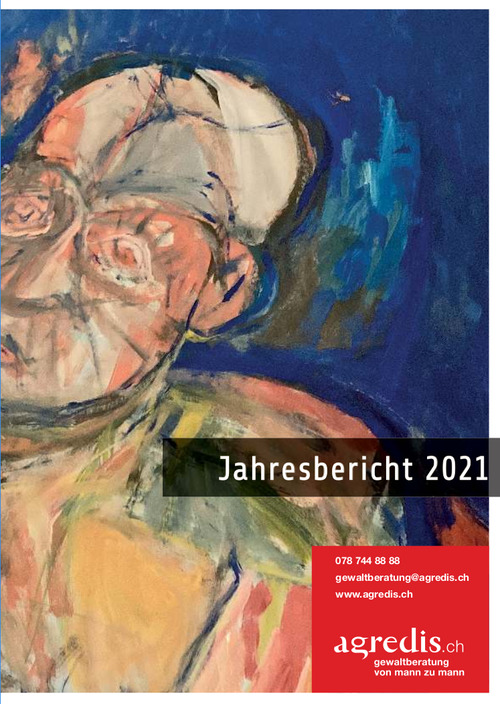Viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens den Zugang zu ihren Gefühlen verloren – oft als Folge von Anpassung, Überforderung oder anderen unangenehmen Erfahrungen. Dabei sind unsere Gefühle essenziell, um Grenzen zu spüren, Bedürfnisse wahrzunehmen und in echten Kontakt mit uns selbst und anderen zu kommen. Der Prozess, sich selbst wieder wahrzunehmen und Gefühlen Raum zu geben, ist ein zentraler Bestandteil in unseren Beratungen.
Gefühle sind unser innerstes Navigationssystem. Sie zeigen uns, was uns wichtig ist, was uns verletzt, was uns lebendig macht. Doch viele von uns haben im Laufe ihres Lebens verlernt, ihre Gefühle klar wahrzunehmen – geschweige denn, ihnen zu vertrauen.
Als Kinder fühlen wir noch direkt: Freude, Angst, Wut, Traurigkeit – alles ist da, unmittelbar, ungefiltert. Doch mit der Zeit lernen wir: «Das darfst du nicht fühlen.» «Das ist zu viel.» «So benimmt man sich nicht.» Und so beginnen wir, Teile unseres emotionalen Erlebens abzuspalten. Wir passen uns an, funktionieren, übergehen unsere Grenzen – oft, ohne es zu merken.
Was bleibt, ist eine diffuse Leere oder ein inneres Taubheitsgefühl. Viele Menschen sagen dann: «Ich weiss gar nicht, was ich fühle.» Oder: «Ich spüre mich nicht richtig.» Damit fehlt die Grundlage für echten Kontakt – mit sich selbst und mit anderen. Denn wie kann ich mich zeigen, wenn ich gar nicht weiss, was in mir ist? Wie kann ich meine Grenzen wahrnehmen, wenn ich meine Gefühle nicht spüre?
Der Weg zurück beginnt mit Wahrnehmung. Mit dem Innehalten. Mit der Bereitschaft, wieder zu lauschen: Was fühle ich gerade – jetzt, in diesem Moment? Das ist oft nicht einfach. Denn wenn wir beginnen, uns selbst wieder zu spüren, kommen nicht nur angenehme Gefühle, sondern auch Schmerz, Traurigkeit, Scham oder Angst zum Vorschein – all das, was wir lange weggeschoben haben.
Doch gerade darin liegt die Chance: Wer seine Gefühle wieder wahrnehmen kann, findet zurück zu sich selbst. Gefühle markieren unsere innere Grenze. Sie zeigen uns, was uns guttut – und was nicht. Sie helfen uns, Ja oder Nein zu sagen. Und sie ermöglichen, dass wir im Kontakt mit anderen authentisch und stimmig sind. Nicht perfekt, aber echt.
Diese Echtheit braucht Mut – vor allem, wenn wir gelernt haben, dass es gefährlich ist, sich zu zeigen. Doch wie schon gesagt: Mut kann man nur haben, wenn man Angst hat. Wenn wir lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten, entsteht ein innerer Raum der Sicherheit. Aus diesem Raum heraus können wir uns zeigen – und wirklich in Kontakt treten.
Kontakt bedeutet dann nicht mehr, sich anzupassen oder zu verstecken. Sondern: sich mitzuteilen. Mit allem, was da ist. Und sich dabei nicht zu verlieren – sondern mehr und mehr zu sich selbst zu finden.